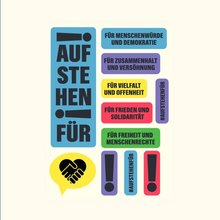Freitag, 07. Juni 2024
Aufstehen für …! – Sitzenbleiben mit …?
Am 17. Mai startete das Bistum Speyer gemeinsam mit der Evangelischen Kirche der Pfalz anlässlich der Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni die Kampagne „Aufstehen für“, um für Menschenwürde und Demokratie einzustehen. Auf der Homepage heißt es: „Als Christinnen und Christen setzen wir uns für die Gleichheit und Freiheit aller Menschen ein, unabhängig von Alter, Herkunft oder Glauben. Wir bekennen uns zu einer solidarischen Kirche, die ihren Mitmenschen mit Nächstenliebe, Offenheit und Toleranz begegnet.“
Ziemlich cool, dass sich die beiden Kirchen dafür einsetzen! Gerade vor den Wahlen kann es nicht genug Menschen geben, die sich für diese Inhalte stark machen und zeigen, dass ihnen Menschenwürde und Demokratie am Herzen liegen!
Noch cooler wäre, wenn sich – meinetwegen nach den Wahlen – das Bistum Speyer als katholische Institution dafür stark machen würde, dass die Kirche diesen formulierten Ansprüchen selbst genügt. Denn auf Seite 4 der Handlungsempfehlungen heißt es, es brauche eine „ehrliche Benennung dessen, wo wir innerkirchlich hinter den Ansprüchen zurückbleiben, die wir nach Außen vertreten und von anderen einfordern, v.a. mit Blick auf demokratische Entscheidungsprozesse, die Gleichberechtigung der Frau und den Umgang mit Homosexuellen“.
Mir kommt diese Benennung bisher in der Berichterstattung und in den Kommentaren zur Kampagne zu kurz, weshalb ich die Handlungsempfehlung gerne aufgreife und diese Aufgabe übernehme, indem ich die Positionierungen der Kampagne mit amtskirchlichen Ereignissen und Verlautbarungen aus Rom verknüpfe:
„Wir grenzen uns ab … von einem Denken, das die im Grundgesetz garantierten Grundrechte nicht allen Menschen bzw. Bevölkerungsgruppen in gleicher Weise zuerkennt“ und „… von Rollenbildern, die die Unterdrückung von Frauen fördern“:
Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland schreibt in Artikel 3: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt.“ Schaut man in die katholische Kirche, findet man dort zwar allmählich Bemühungen vor, Frauen in Leitungsämter zu bringen. Aber trotzdem erleben alle Frauen eine grundlegende Diskriminierung, wenn es um die Zulassung zum Weiheamt geht. Berufungen, von denen beispielsweise in Schwester Philippa Raths Buch „…weil Gott es so will: Frauen erzählen von ihrer Berufung zur Diakonin und Priesterin“ zu lesen ist, werden an dieser Stelle mit Füßen getreten. Gerade erst am 19. Mai 2024 sagte Papst Franziskus unmissverständlich „Nein“ zur Diakoninnen-Weihe von Frauen. Nicht nur ich bin verwundert, sondern selbst Bischof Bätzing ist „etwas irritiert“. Der Papst jedenfalls begründet: „Frauen haben immer, würde ich sagen, Aufgaben einer Diakonin übernommen, ohne Diakon zu sein. Frauen sind großartig im Dienst als Frauen, aber nicht im Dienst mit Weihe.“ Wenn ich das höre, macht sich ein ungutes Gefühl in mir breit, weil mir der Satz verdächtig parallel scheint zu „Frauen machen die gleiche Arbeit, aber eben für weniger Geld“. In unserer Gesellschaft wird dies als „Gender-Pay-Gap“ inzwischen angeprangert und dagegen vorgegangen. Der Papst hingegen scheint sich nicht zu schämen, diese Ungleichbehandlung, ja, diesen „Etiketten-Schwindel“ sogar als gutes Argument für ein Fortführen der Diskriminierung anzubringen. Er zementiert damit die Rolle der Frau als eine Person, deren Leistung nicht in angemessenem, gleichwertigem Maße honoriert und sichtbar gemacht wird. Unterdrückung wird nicht aufgelöst, sondern gefördert. Aber klar, Frauen sind eben in erster Linie über ihre Geschlechtlichkeit als Frau zu definieren – so suggeriert sein nachfolgender Satz. Das Frau-Sein ist es, was ihre Möglichkeiten und Spielräume im Leben bestimmt. Gesellschaftlich sind wir – zumindest in Deutschland – inzwischen an einem ganz anderen Punkt angelangt, wenn darum gekämpft wird, dass geschlechtliche Zuordnungen von Berufen aufgelöst, bewusst Rollenbilder gebrochen und Menschen nicht mehr nach ihrem Geschlecht, sondern ihrer Fähigkeit beurteilt werden. Das ist ein großes Glück für alle Frauen – und ein großes Pech für die Kirche, denn so gerät sie immer mehr ins Abseits. Im 19. Jh. wäre sie noch ungeschoren davongekommen, aber heute entwickelt sie sich immer mehr zu einer Parallel-Welt voller längst veralteter Ansichten.
„Wir grenzen uns ab … von der Verweigerung einer Anerkennung unterschiedlicher Interessen und Ablehnung demokratischer Wege der Entscheidungsfindung, die auf Kompromisse zielen.“
„Roma locuta, causa finita“, dieser kirchenrechtliche Grundsatz hat sogar Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden, wenn es darum geht, Machtworte kenntlich zu machen. Klar ist: Die katholische Kirche ist alles andere als demokratisch. In ihrer kirchenrechtlichen Verfasstheit ist eine demokratische Struktur auch gar nicht angelegt: Der Papst und die Bischöfe sind die, die die Macht qua ihrer Weihe in Händen halten. Um dem beizukommen, versucht sich die Kirche neuerdings an Synodalität. Der Synodale Weg und die Weltsynode sind dafür Beispiele, die Veränderungen bringen sollen. Wenn aber Entscheidungen abgelehnt werden, weil zwar über 80 % der Anwesenden zustimmen, aber letztlich die Zweidrittelmehrheit der Bischöfe fehlt oder Briefe aus Rom genügen, um den Synodalen Rat in Deutschland lahmzulegen, kann man sich fragen, wie ernst das mit der gemeinsamen Entscheidung von Klerikern und den sogenannten „Lai*innen“ (die – nebenbei bemerkt – in den meisten Fällen hervorragend ausgebildete Theolog*innen sind) eigentlich gemeint ist… Von Kompromissbereitschaft und einem Austausch auf Augenhöhe ist an diesen Stellen jedenfalls nichts zu sehen.
„Wir grenzen uns ab … von einer elitären Ideologie, die Politik nur für bestimmte Gruppen macht.“
An dieser Stelle kann das Christentum viel Positives in die Waagschale werfen, denn eine seiner großen Stärken ist, dass es an einen Gott glaubt, der für alle da ist, der Grenzen aufweicht und alle mit hineinnimmt in seine Verheißung vom Reich Gottes. Der christliche Gott ist einer, der sich nicht zu schade ist, mit Kranken, Alten, Großen, Kleinen, Reinen, Unreinen, Verbrechern und „Heiligen“ … gemeinsam unterwegs zu sein und am Ende durch seinen Tod sogar Auferstehung und ewiges Leben für alle zu ermöglichen. Davon erzählt die Bibel und das war und ist die Faszination, die der christliche Glaube entfalten kann. Was für eine Botschaft! Darauf können wir richtig stolz sein!
Und das sind wir auch – leider schon fast zu sehr. Denn die Botschaft ist kein Selbstläufer. Vor lauter Hinweisen auf die tolle christliche Botschaft verlieren wir aus den Augen, dass wir dieser Botschaft auch verpflichtet sind, denn für die richtige Entschlüsselung beim Empfänger gehört noch so viel mehr als die pure Existenz eines gütigen Gottes. Es kommt auf das Wirksamwerden dieses Glaubens in der irdischen Welt an. Und das gelingt meist über die Kirchen und ihre Mitglieder. Durch die 6. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung von 2023, an der erstmals auch die katholische Kirche in Deutschland beteiligt war, tritt Alarmierendes zu Tage: 73% der Katholik*innen erwägen einen Kirchenaustritt. Warum? Aus Wut und Zorn auf die Kirche. Gewichtige Gründe dafür sind unter anderem: „Wegen der kirchlichen Skandale, z. B. zu sexuellem Missbrauch und seiner Vertuschung“, „Weil ich andere Werte habe als sie die Kirche vertritt“, „Weil mir der innere Aufbau der Kirche zu hierarchisch und undemokratisch ist“, „Weil ich mich über kirchliche Stellungnahmen geärgert habe“, „Weil die Kirche der Gleichstellung von Frauen nicht nachkommt“ und „Weil die Kirche nicht das lebt, was Jesus eigentlich wollte“…
Die christliche Botschaft wird da kaum mehr wirksam, im Gegenteil: Für die Menschen ist kirchliches Handeln nicht kompatibel zur Botschaft. Glaubwürdigkeits- und Vertrauensverlust nehmen immer weiter zu.
Schade, denn obwohl sich die Kirche verstehen will als eine Gemeinschaft, deren Botschaft für alle da ist, erreicht sie realiter nur noch einen geringen Teil der Menschen. Alle anderen (viele Frauen, Queere und Unterstützer*innen dieser Menschen, die selbst nicht zur marginalisierten Gruppe gehören [in der queeren Community „Allies“ genannt], …) fühlen sich – trotz der Botschaft – ausgegrenzt und übergangen. Dazu kommt erschwerend, dass die Kirche bei den Sinus-Milieus ohnehin nur noch drei Milieus erreicht und dadurch per se schon ihren volkskirchlichen Charakter einbüßt. Einen kleinen Trost bietet die Studie: Sollte die Kirche ihre Fehler eingestehen und großangelegte Reformen durchführen, würden viele Menschen nicht austreten. Dann, wenn die Kirche wieder an Glaubwürdigkeit und Vertrauen gewinnt, weil ihr irdisches Bild und ihre Botschaft wieder zusammenpassen, würde sie sich wieder etwas mehr entfernen von einer „Politik für bestimmte Gruppen“ hin zu einer „Glaubenspolitik für alle“.
„Wir grenzen uns ab … von jeder Diskriminierung aufgrund von Religion, Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht oder sexueller Identität.“
Diskriminierung aufgrund von Herkunft und Hautfarbe ist in der Kirche zum Glück vom Lehramt aus betrachtet kein großes Thema – immerhin haben wir eine Weltkirche – und auch der Dialog mit anderen Religionen funktioniert allmählich gut – schließlich war z. B. Jesus selbst Jude und eben kein Christ… Bei Geschlecht und sexueller Identität (in Abgrenzung zu sexueller Orientierung) schaut es da schon ganz anders aus. Über die Diskriminierung von Frauen hinaus kämpft die katholische Kirche noch immer damit, inter- und transsexuelle Menschen anzuerkennen, weil sie weiterhin an der Zweigeschlechtlichkeit, an Mann und Frau, festhält. Alles dazwischen oder außerhalb ist für die Amtskirche nicht vorhanden. In der Erklärung „Dignitas infinita“ aus dem Vatikan aus dem April 2024 ist daher zu lesen: „Über sich selbst verfügen zu wollen, wie es die Gender-Theorie vorschreibt, bedeutet ungeachtet dieser grundlegenden Wahrheit des menschlichen Lebens als Gabe nichts anderes, als der uralten Versuchung des Menschen nachzugeben, sich selbst zu Gott zu machen." Aus diesem Grund sind Trans-Menschen noch immer die Sakramente von Ehe und Weihe versagt und „Geschlechtsumwandlung“ werden als Bedrohung für die Würde des Menschen gesehen. Diese Aussagen sind verheerend für alle Trans-Menschen, die durch ihre Geschlechtsangleichung (!, dieser Begriff ist deutlich wertschätzender und passender) einem glücklichen und authentischen Leben näher kommen wollen – sie würden sicherlich unterschreiben, dass ihre Würde dadurch besonders zur Geltung kommt.
Homosexuellen Menschen, die zwar in der zitierten Positionierung nicht genannt sind, deren sexuelle Orientierung aber in den Handlungsempfehlungen aufgegriffen wird, geht es im kirchlichen Kontext kaum besser. Sie geraten vor allem dann in den Blick des kirchlichen Lehramts, wenn sie in gleichgeschlechtlichen Beziehungen leben. Zwar ist es seit Dezember 2023 erlaubt, Menschen in diesen Beziehungen und auch wiederverheiratet Geschiedene zu segnen, jedoch stellt die Erklärung „Fiducia supplicans“ unmissverständlich klar: „Deshalb soll man die Segnung von Paaren, die sich in einer irregulären Situation befinden, weder fördern noch ein Ritual dafür vorsehen, aber man sollte auch nicht die Nähe der Kirche zu jeder Situation verhindern oder verbieten, in der die Hilfe Gottes durch einen einfachen Segen gesucht wird. In dem kurzen Gebet, das diesem spontanen Segen vorausgehen kann, könnte der geweihte Amtsträger um Frieden, Gesundheit, einen Geist der Geduld, des Dialogs und der gegenseitigen Hilfe für sie bitten, aber auch um Gottes Licht und Kraft, um seinen Willen voll erfüllen zu können.“
„Fiducia supplicans“ stellt an dieser und vielen weiteren Stellen klar, dass eine Segnung von homosexuellen Personen aus pastoralen Gründen nicht versagt werden darf, denn der Segen als Beistand stehe jedem zu – egal wie moralisch verwerflich die Lebenssituation sein mag. Die Beziehung selbst darf jedoch nicht gesegnet werden, sie wird noch immer als dem Willen Gottes nicht entsprechend verstanden. Ein herber Schlag für alle, die in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben und ein glückliches Leben auf Augenhöhe miteinander führen. Hier gelingt es der Kirche erneut nicht, Diskriminierung zu verhindern. Denn selbst wenn eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft nicht äquivalent zu einer kirchlichen Ehe zwischen Mann und Frau zu sehen ist, wäre noch einige Luft nach oben, um homosexuelle Paare oder Paare wiederverheiratet Geschiedener zu integrieren. Ich erlaube mir in Bezug auf Formulierungen aus „Fiducia supplicans“ ein paar Tipps: Auf das Wording kommt es an – „irregulär“ und „moralisch inakzeptabel“ sind keine geeigneten Worte, um gelingende Beziehungen zwischen Liebenden zu beschreiben. Ein Segen „am Straßenrand“ oder in anderen spontanen Situationen ist einer Beziehung zwischen Liebenden nicht angemessen. Und zu guter Letzt: Wenn Menschen sich wahrhaft lieben, muss man sie in diesem Punkt wirklich nicht von „Unvollkommenheiten und Schwächen befreien“.
Mal ehrlich …
Schaut man über die offiziellen Verlautbarungen der katholischen Kirche in den letzten Jahren, kann man schon ins Grübeln kommen, wenn die katholische Kirche in Gestalt des Bistums Speyer sich gegen Diskriminierung und für Demokratie einsetzt. Für mich tut sich dort eine gewaltige Kluft auf zwischen den Maßstäben, die vor, und den Maßstäben, die hinter der Kirchentür gelten sollen – irgendwie schizophren, das Ganze …
Um diese Spannung ein wenig aufzulösen, möchte ich noch einen letzten Vorschlag anbringen und die Handlungsempfehlung von der Benennung der Kluft hin zu ihrer Beseitigung erweitern:
Wie wäre es, wenn wir nach der Wahl und dem Ende der Kampagne einfach weiter „auf der Welle surfen“? Wenn die Fahnen mit dem Motto der Initiative „Aufstehen für“ vor dem Dom hängen und die Aufkleber kleben bleiben, weil jetzt im ganzen Bistum die Energie gebündelt wird, damit unsere Kirche endlich diskriminierungsfreier wird?
Dann würden wir nicht mehr „sitzenbleiben mit …“ all den unerfüllten Ansprüchen und der Kluft zwischen dem, was wir von anderen erwarten, und dem, was wir selbst bieten können.
Dann könnten wir endlich erleichtert und aus vollem Herzen „aufstehen für …“ – und vielleicht könnten wir sogar beschwingt loslaufen und noch viel mehr versuchen …
PS: Wenn Sie sich zur Thematik austauschen wollen, besteht die Möglichkeit am 20. Juni 2024 um 19:30 Uhr. Im Rahmen einer Online-Veranstaltung kommen wir mit der Theologin Luisa Eisele, Mitgründerin der Initiative „Mein Gott diskriminiert nicht. Meine Kirche schon.“ und den geistlichen Verbandsleitungen der Jugendverbände des BDKJ Speyer darüber ins Gespräch, was die Kirche für uns (noch) ausmacht, warum wir trotz der manchmal bestehenden Zweifel und Kritik an ihr immer noch bleiben und was es braucht, um (wieder) gerne katholisch zu sein.
Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
Sonja Haub, Bildungsreferentin